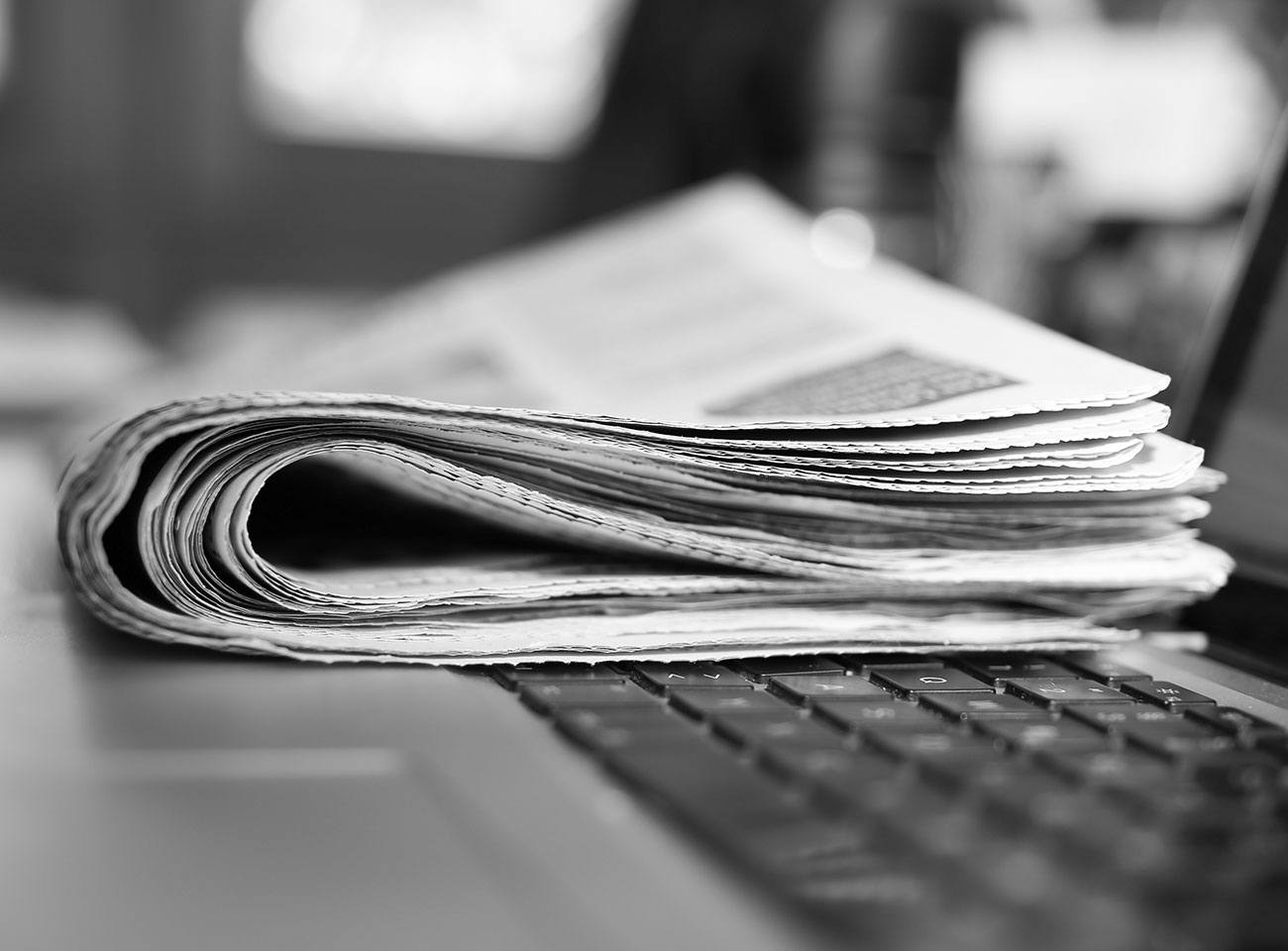Interview Andreas Mattfeldt mit dem Oytener Heizungsfachbetrieb HWT Hansen zur Gebäudesanierung
Die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) hat seit Veröffentlichung des ersten Ampel-Konzeptpapiers im Juni 2022 für viel Verunsicherung gesorgt und mit sinkenden Modernisierungen genau das Gegenteil dessen erreicht, was es erreichen sollte. Im Interview mit dem Oytener Heizungsfachbetrieb HWT Hansen bespricht Andreas Mattfeldt, welche Probleme durch die Novellierung entstanden sind und wie ein künftiges Konzept aussehen könnte.
Andreas Mattfeldt: Wie ist Ihre Einschätzung als Fachbetrieb zum aktuellen Stand der energetischen Gebäudesanierung?
HWT Hansen: An sich geht es voran – gerade bei Neubauten leisten die über 49.000 Heizungs- und Sanitärbetriebe deutschlandweit eine gute Arbeit. Der Vorteil bei Neubauten ist allerdings, dass Bau, Dämmung und Heizung direkt zusammengedacht werden können. Dagegen haben wir aber auch über 19,6 Millionen Bestandsgebäude in Deutschland. Hier sieht die Sache komplexer aus. Dazu hat uns das Gebäudeenergiegesetz (GEG) von Bundesminister Robert Habeck einen Bärendienst erwiesen.
Andreas Mattfeldt: Das GEG wurde 2020 von der Union eingeführt, um die verschiedenen Gesetze einheitlich zu fassen und damit Maßnahmen zu vereinfachen. Seit das Bundesministerium für Wirtschaft unter Robert Habeck die Novellierung beschlossen hatte, nehmen viele Bürger das Gesetz als rotes Tuch wahr. Ich erinnere mich auch noch an Anrufe von verzweifelten Bürgern, die nach dem ersten, weitreichenden Konzept um ihre Existenz bangten. Sie wussten schlichtweg nicht, wie sie den Heizungstausch hätten finanzieren sollen. Welche Erfahrung haben Sie als Fachbetrieb mit dem neuen GEG gesammelt?
HWT Hansen: Das Hauptproblem war seinerzeit die Kommunikation. Das erste Konzept war überambitioniert und an der Realität vorbei geschrieben. Das hat die Leute natürlich erheblich verunsichert. Das letztendliche Gesetz ist durch die immense Kritik von Bürgern, Politik und Fachbetrieben realitätsnäher geworden, aber die Verunsicherung ist unserer alltäglichen Erfahrung nach geblieben.
Andreas Mattfeldt: Wie ist denn Ihre fachliche Einschätzung zum aktuellen Gesetz?
Antwort: Zusammengefasst: Das Gesetz setzt an der falschen Stelle an und hat sogar zu nachteiligen Effekten bei der Modernisierung gesorgt. Wir bauen weniger Wärmepumpen ein, als vor dem Gesetz.
Andreas Mattfeldt: Die Union will das Gesetz wieder weitestgehend zurücknehmen – ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg?
HWT Hansen: Das Problem des GEG ist, dass es ja nicht alleine steht, sondern mit der kommunalen Wärmeplanung sowie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) verknüpft wurde.
Die kommunale Wärmeplanung ist ein wesentlicher Grund, warum der Absatz von Wärmepumpen eingebrochen ist. Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern sollen zum 30. Juni 2026 und Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern sollen zum 30. Juni 2028 ihre Wärmeplanung vorlegen, die darüber entscheidet, wie die Bürger heizen dürfen. Das heißt zum einen haben wir momentan Bürger, die versuchen, dieses Datum abzuwarten, obwohl es sich lohnen würde bereits jetzt eine neue effiziente Heizung einzubauen. Zum anderen haben wir erhöhte Absätze von Gas- und sogar Ölheizungen, da die Bürger verunsichert sind und Angst vor Herausforderungen nach Fertigstellung der kommunalen Wärmeplanung haben. Denn die jetzt noch schnell eingebauten Heizungen dürfen weiter betrieben werden. Das Gesetz hat also genau das Gegenteil von dem erreicht, dass es erreichen wollte.
Andreas Mattfeldt: Mein Eindruck ist, dass der Begriff „Wärmepumpe“ oft als sehr negativ dargestellt wird, obwohl wir hier ja eigentlich eine sehr effektive Wärmeerzeugung haben, wenn sie korrekt angewandt wird. Der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe ist durchschnittlich drei bis viermal mal höher als der einer Gas- oder Ölheizung. Damit ist die Wärmepumpe weitaus effizienter als fossile Heizsysteme.
HWT Hansen: Das stimmt. Es wird auch nicht zwischen den verschiedenen Arten von Wärmepumpen unterschieden – wobei hier auch das Ministerium den Fehler begeht.
Andreas Mattfeldt: Inwiefern?
HWT Hansen: Vielfach wird an die Luftwärmepumpe gedacht, obwohl eine Erdwärmepumpe zwar teurer in der Anschaffung ist, aber erhebliche Vorteile gegenüber der Luftwärmepumpe hat, da die Temperaturen im Erdreich auch im Winter konstant sind. Anders sieht dies aus bei der Luftwärmepumpe, deren Effizienz stark von der Außentemperatur abhängt und daher gerade in kalten Jahreszeiten, wenn sie am meisten gebraucht würde, am ineffizientesten ist. Erdwärmepumpen eignen sich natürlich nicht für dichte Besiedelungen, da sie freien Platz für die Bohrung brauchen, aber wir gehen davon aus, dass etwa in den Landkreisen Verden und Osterholz 80 bis 90 Prozent aller Haushalte so versorgt werden könnten. Leider wird auch bei der dem GEG entsprechenden Förderung kein Unterschied gemacht, sodass viele Hauseigentümer wenn dann zur Luftwärmepumpe greifen. Das fördert Stromspitzen, die durch das Starten des Kompressors in der Außeneinheit der Wärmepumpe entstehen und unser Netzt stark beanspruchen. Zudem sorgt dies für einen erhöhten Geräuschpegel in der Umgebung.
Andreas Mattfeldt: Thema Förderung: Als Haushälter sehe ich die Kosten für den von Habeck als Experiment bezeichneten Heizungstausch. Allein für Neuzusagen kamen im Jahr 2024 2,36 Milliarden Euro zusammen. Ich bin überzeugt, wir müssen die Gesetze zur Sanierung und die anschließende Förderung wieder pragmatischer ausgestalten. Dort ansetzen, wo wir mit Sanierung und Heizungstausch die größten Effizienzgewinne erzielen, also bei sehr alten Heizungen und schlecht gedämmten Altbauten. Über günstige Strompreise und ausdifferenzierte Förderungen nach Anlagenalter müssen wir die Bürger zum Austausch motivieren, statt sie mit vorschnellen Pflichten zu demotivieren. Das ist die politische Sicht, wie ist hier Ihre fachliche Meinung?
HWT Hansen: Wir halten dies für den richtigen Weg. Wir sehen viele alte Anlagen, die noch betrieben werden und dazu meist ineffizient, weil die Bürger schlicht nicht wissen, wie viel sie durch einen passenden Anlagentausch oder zumindest erstmal durch eine Kalibrierung der Anlage an CO2, aber vor allem Geld, sparen könnten. Deswegen sollte der Staat mit Förderungen genau hier ansetzen und einen Geschwindigkeitsbonus je nach Anlagenalter einführen. Das Alter der Anlage ermöglicht eine grobe Einschätzung ihrer Ineffizienz, ohne zusätzlichen bürokratischen Aufwand oder datenschutzrechtliche Bedenken, die bei einer Erfassung des Verbrauchs entstehen könnten. Auch die Förderung je nach Technologie halten wir unabdingbar, um den vielfältigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen und tatsächlich die effizienteste Technologie für einzelnen jeden Haushalt auszuwählen. Optimal sollte eine Förderung zudem Dämmung, effiziente Wärmeerzeugung, Photovoltaik-Anlage und Speicher zusammen denken. Das hilft den Bürgern und entlastet unser Netz von Stromspitzen.
Andreas Mattfeldt: Vielen Dank für das tolle Gespräch. Die Union wird das Gebäudeenergiegesetz nach der Wahl nicht abschaffen. Wir wollen es aber zu einer praxisnahen Lösung für Bürger, Unternehmen und Kommunen zurückführen, die statt auf Belastung wieder maßgeblich auf Motivation und Angebote setzt und die individuellen Gegebenheiten der Bürger und Gebäude berücksichtigt. Statt auf weitere Verbote und Pflichten wollen wir uns auf das etablierte CO2-Preissystem verlassen.